

Die Auswahl der im Technology Outlook vertretenen Technologie erfolgt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsgesellschaften der SATW, der Themenplattformen und dem wissenschaftlichen Beirat. Diese Gremien und Organe werden eingeladen, Vorschläge einzureichen. Aus diesen Vorschlägen entsteht eine Longlist, die dann bei Expert:innen aus den Fachbereichen zirkuliert. Die Technologien werden nach bestimmten Relevanzkriterien bewertet, auf Basis von quantitativen wie qualitativen Grössen wird dann eine Shortlist erstellt.
Der Technology Outlook nutzt die kollektive Intelligenz von Expert:innen aus den verschiedenen Bereichen der technischen Wissenschaften. So ist der Outlook das Ergebnis eines zwei Jahre dauernden Foresight-Prozesses. Grundlage dieses Prozesses ist das Wissen von 150+ Expert:innen. Er stützt damit seine Aussagen auf:
Meinungen/Einschätzungen von Expert:innen
Recherchen des Foresight-Teams der SATW
Muster, die zwischen den Einzeltechnologien und über die verschiedenen Beiträge hinweg, auftauchen.
All dies im Abgleich und Gespräch mit Mitgliedern der SATW, den verschiedenen Gremien wie dem wissenschaftlichen Beirat und dem Industriebeirat der SATW.
Um die Qualität und Relevanz der Aussagen hochzuhalten, werden alle Texte, die im Technology Outlook veröffentlicht werden, einem Reviewprozess unterzogen. Alle Beiträge werden also von externen Stellen gelesen und ihre Inhalte und Aussagen kritisch hinterfragt.
Trotz oder wegen dieser grundsätzlich ausgezeichneten Ausgangslage fällt es Unternehmen aus traditionelleren Branchen und KMU zunehmend schwer, den Anschluss an die digitale Transformation nicht zu verlieren; sprich mitzuhalten und das Geschäftsmodell an die neuen Gegebenheiten anzupassen.
In eine ähnliche Kerbe schlägt der Umstand, dass es hierzulande eine Diskrepanz zwischen hochkarätiger Grundlagenforschung und einer hinterherhinkenden Kommerzialisierung von Technologien gibt. Die Schweiz muss Jungunternehmertum fördern, dafür sorgen, dass es genügend Risikokapital gibt und Bedingungen schaffen, die es wissens- und technologieintensiven Startups und Spin-offs ermöglicht, entsprechende Infrastruktur zu nutzen.
Mit den Technologiebeiträgen nimmt der Technology Outlook Technologien ins Visier, die in fünf bis zehn Jahren Markt- und Produktreif sind, also zwischen angewandter Forschung und Produktentwicklung stehen. Maschinelles Lernen und viele der anderen gängige Verfahren der künstlichen Intelligenz sind unterdessen produktreif und werden derzeit mit grossem Eifer kommerzialisiert, sie sind also weit über das Stadium hinaus, auf das die Technologiebeiträge in unserem Outlook fokussieren. Weil derzeit viele interessante KI-Anwendungen auf den Markt kommen, wird KI als Thema bei den Showcases behandelt.
Gleichzeitig nimmt die digitale Transformation weiter Fahrt auf; dass weniger digitale Technologien im Outlook vertreten sind, ist ein Zeichen dafür, dass diese voranschreitet und die Bedeutung digitaler Technologien zunimmt. Darauf geht auch der Text zu den nationalen Trends ein.
Es gibt keine einfache Antwort auf die Frage, wie Rohstoffkreisläufe geschlossen werden können. Und die Antwort wird nicht rein technologisch sein. Es braucht dazu Gesetze und Regulierungen, es wird einen Wertewandel und ein verändertes Bewusstsein von Produzent:innen und Konsument:innen geben müssen, dies betrifft auch die Art und Weise wie Innovation gedacht wird. Folgen für das Produktdesign, für Geschäftsmodelle, ganze Branchen und wahrscheinlich auch auf die Wirtschaftsstruktur im Ganzen.

Die Daten für den DBP werden über den gesamten Lebenszyklus der Batterie gesammelt:
Herstellung: Automatisierte Systeme in den Fabriken erfassen Materialzusammensetzung und Produktionsdaten.
Nutzung: Das Batteriemanagementsystem im Fahrzeug liefert kontinuierlich Informationen zu Ladezyklen und zum Zustand der Batterie.
Datenkorrektheit: Die Integrität der relevanten Ereignisdaten wird beim BloqSens-Batteriepass durch Blockchain-Technologie gesichert. Einmal erfasste Daten können nicht mehr verändert werden. Zudem sichern Audits die Verlässlichkeit der Datenerhebung.
Der Austausch dieser Daten erfolgt innerhalb eines sicheren, dezentralen Datenraums. Ein Beispiel dafür ist Catena-X, ein offenes und kollaboratives Datennetzwerk, das den sicheren Austausch von Daten zwischen Unternehmen in der Automobilindustrie ermöglicht. Dies stellt sicher, dass sensible Informationen bei den jeweiligen Unternehmen verbleiben (Datenhoheit) und nicht in einer zentralen Cloud gesammelt werden.
Der Anteil von E-Auto-Batterien mit Digitalem Batteriepass ist heute noch beinahe null.
Die EU-Batterieverordnung macht den Pass ab dem 18.Februar 2027 für alle neuen Industrie- und Elektrofahrzeugbatterien mit einer Kapazität über 2 kWh zur Pflicht.
Die Prognose ist eine 100%ige Verbreitung für alle neu in der EU in Verkehr gebrachten Batterien, was zu mehr Transparenz und effizienterem Recycling führen wird.
Der Schutz der Daten wird durch ein Blockchain-basiertes Berechtigungssystem gewährleistet:
Datensicherheit: Die Daten werden auf einer sicheren Plattformen gespeichert.
Zugriffskontrolle: Jeder Akteur (z.B. Fahrzeughalter, Inverkehrsetzer der Batterie, Recycler, Garage etc.) hat nur auf die Daten Zugriff, die er für seine spezifische Aufgabe benötigt anhand des "Need-to-know-Prinzips". Beispiele: Der Fahrzeughalter sieht nur Nutzungsdaten, der Recycler erhält Informationen zur Materialzusammensetzung.
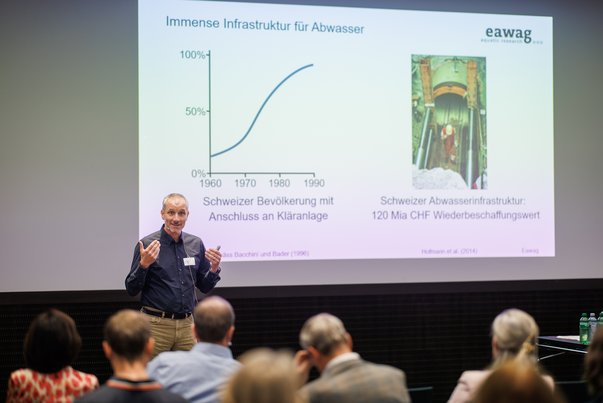
Medikamentenrückstände werden teilweise biologisch abgebaut aber vor allem mittels Adsorption auf Aktivkohle entfernt. Dies ist ein etabliertes Verfahren in der Abwasserreinigung.

Ja, es gibt zahlreiche Beispiele für bioinspirierte Materialien, die in der Industrie eingesetzt werden. Klettverschlüsse sind das ursprüngliche Beispiel, während von Muscheln inspirierte Catechol-Klebstoffe in der Chirurgie verwendet werden. Unternehmen wie BASF, Dow, DSM und andere Chemieunternehmen sind daran interessiert, parallel zu ihren biobasierten Verbindungen neue Materialien zu testen. Ein Beispiel aus der Schweiz ist HeiQ (ein Spin-off der ETH Zürich), das seit Jahren Textilien mit bioinspirierten wasserabweisenden Oberflächen verkauft (basierend auf der Oberflächenstruktur von Lotusblättern).
Es gibt keine festgelegten Methoden, da sich einige Forscher auf Effekte konzentrieren, während andere sich auf Strukturen konzentrieren. Das Verständnis erfolgt entweder auf einer sehr hohen Ebene («Die Natur verfügt über eine Vielzahl von durch die Evolution verbesserten Strukturen und Prozessen») oder auf einer detaillierten Ebene («Warum und wie sehen diese Strukturen so aus, wie sie aussehen, zu welchem Zweck wurden sie entwickelt und warum funktionieren sie überhaupt?»), was zu vielen grundlegenden Fragen hinsichtlich der Zellprogrammierung, der Anpassung an die Umwelt und zu vielen, vielen Simulationen führt. Ich bin mir nicht sicher, ob Bio-Inspiration an sich das Verständnis fördern kann, aber sie hat sicherlich viele neue Fragen aufgeworfen, die zu wissenschaftlichem Verständnis und Innovation geführt haben.